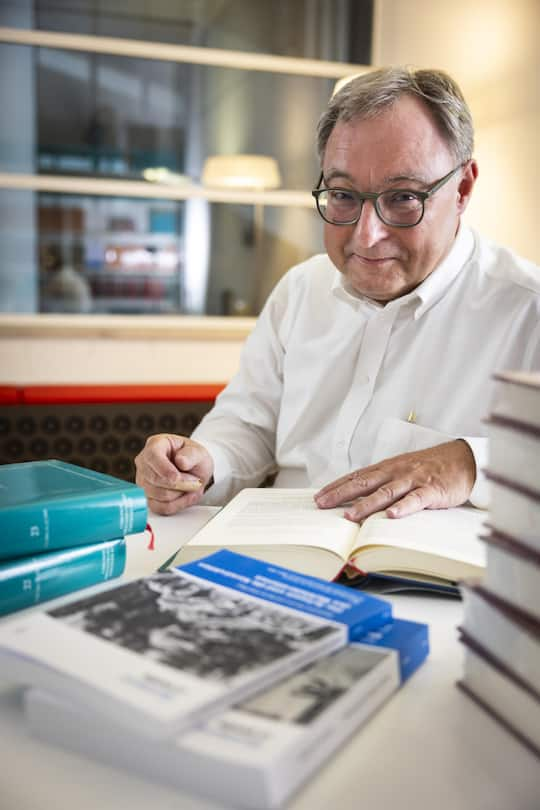Das Büro von Sacha Zala (56) am Historischen Institut der Uni Bern wirkt asketisch: aufgeräumte Tische, keine persönlichen Gegenstände, keine Schreibutensilien. Einzig das Bücherregal ist vollgepackt. «Das sind alle unsere Publikationen – ziemlich paradox, denn wir ticken ja voll digital», sagt der Leiter der Forschungsstelle Diplomatische Dokumente der Schweiz. Eigentlich seien die Lesesäle im Bundesarchiv sein Arbeitsplatz. «Wir sind der grösste Kunde, und Die die Angestellten des Bundesarchivs legen jährlich viele Kilometer zurück, um uns die Archivschachteln zu bringen.» Dabei kriegt er immer wieder mal Besuch: «Bundesrätin Ruth Dreifuss und Bundesrat Adolf Ogi waren auch schon bei uns zu Gast!»
Herr Zala, welches ist die grösste Krise, in der die Schweiz je gesteckt hat?
Jetzt stürzen Sie mich in eine Krise! (Lacht.) Ernsthaft: Das ist wohl das Jahrzehnt um den Ersten Weltkrieg. Wir waren damals ein geteiltes Land. Als der deutsche Kaiser Wilhelm II. 1912 nach Zürich kam, waren die Deutschschweizer ganz aus dem Häuschen. Darauf mahnte die welsche Presse: «Passt auf, der Kaiser ist ein Verführer! Wir sind neutral!» Hinzu kam, dass die Spanische Grippe grassierte und die Schweiz sich im Landesstreik befand. Eine unglaublich aufgeladene Zeit.
Und wie reagierte die Schweiz auf diese Krise?
Schritt für Schritt schuf sie ein Regierungssystem, das auf dem Prinzip des Konsenses basiert. Entscheidungen werden nicht durch Mehrheitsbeschlüsse, sondern durch eine möglichst breite Einigung aller beteiligten Parteien getroffen. Damit hat die Schweiz ein System geschaffen, in dem es eigentlich keine Krisen geben kann und in dem Probleme neutralisiert werden. Aber natürlich gibt es sie trotzdem.
Befinden wir uns seit Trumps Zollhammer von 39 Prozent in der Krise?
Zuerst mal etwas zum Begriff: Krise kommt aus dem Französischen und wurde im 18. Jahrhundert ins Deutsche übernommen. Ursprünglich eher ein militärischer Begriff, ist eine Krise heute eine Herausforderung, welche mit herkömmlichen Mitteln nicht gelöst werden kann. Das trifft wohl auf den Zollstreit mit den USA zu.
Gab es in der Geschichte eine vergleichbare Situation?
Tatsächlich gab es die um 1950. Die USA drohten mit der Aufkündigung des Handelsvertrags von 1936 mit der Schweiz, wenn diese sich weigerte, eine Ausweichklausel in den Vertrag aufzunehmen. Die Klausel ermöglichte es, bei gewissen Gütern, die für Amerikas Wirtschaft schädlich waren, aus dem Vertrag auszusteigen.
Welche waren das?
Uhren! In den 50er-Jahren haben die Schweizer Uhren den amerikanischen Markt bis fast zu 80 Prozent beherrscht. Darunter litt die amerikanische Industrie. Zudem brauchten die USA die Uhrwerke, weil diese ein Bestandteil von Bomben waren. Weil die Schweiz angesichts der Bedeutung ihrer Handelsbeziehungen zu den USA gezwungen war, die Klausel zu akzeptieren, wurden über 10'000 Personen in der Uhrenhochburg Jura arbeitslos.
Und warum trifft es uns heute besonders hart?
Klar ist es absurd, was Donald Trump macht – aber entgegen unserer Selbstwahrnehmung von einer Alpenidylle ist die Schweiz eine Wirtschaftssupermacht im Kleinen. Etwa im Goldhandel. Im Gegensatz zu anderen Ländern reagieren wir aber auf Kritik völlig beleidigt und masslos enttäuscht. Die Schweiz ist besessen von ihrem Image.
Bisher konnte sich die Schweiz auch immer irgendwie durchwursteln!
Der unglaubliche Wohlstand hat dazu geführt, dass man denkt: Bisher sind wir gut gefahren, wir sollten nichts ändern. Aber ehrlich: Wären wir wie Liechtenstein im EWR, hätten wir heute das Zollproblem nicht.
Aber wir hätten andere Probleme
Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin Historiker, kein Euro-Turbo. Objektiv habe ich aber nicht den Eindruck, dass Liechtenstein im EWR untergegangen ist.

«Was unser Bundesrat in Krisen nie macht, ist zurücktreten. Das ist im Ausland anders», sagt der Historiker.
Kurt ReichenbachIhre Forschungsstelle wählt Schlüsseldokumente aus – auch zu grossen Krisen – und publiziert jährlich Tausende davon. Wie ist es, Dokumente anzuschauen, die 30 Jahre niemand sehen durfte?
Es ist also nicht so, dass ich eine Art Indiana Jones bin, der den Heiligen Gral findet. Denn auch schon bekannte Dokumente können neue Fragen beantworten. Aber wir stellen Wegmarken für künftige Forschungen.
Wie gehen Sie konkret vor?
Wir schauen etwa 1,5 Millionen Dokumente pro Jahr im Bundesarchiv an und wählen 1500 aus. Das ist etwa ein Promille. Das Gewaltige, was die Forschungsgruppe leistet, ist also, was man nicht sieht: die Selektion.
Wie selektieren Sie?
Indem wir etwas für interessant befinden oder nicht. Wir wählen Dokumente, die eine möglichst schöne Übersicht geben – und in den Fussnoten kann man die anderen Dokumente online vernetzen. Mein Grossvater besass Rebberge im Veltlin, so nenne ich das die Weintrauben-Theorie. Der Stiel der Traube kommt ins Buch und die Benutzer können diesen ziehen und dann hat es in den Fussnoten ganz viele digitale Beeren, die sie bei Bedarf essen können (strahlt).
Zeigt die Geschichte nicht, dass die Schweiz immer einen Weg findet aus der Krise. Auch wenn mit teilweise zwielichtigen Geschäften wie etwa dem Nazigold.
Wenn die Schweiz sanktioniert wird, kann sie nicht lange durchhalten. Das war zum Beispiel der Fall im Zweiten Weltkrieg mit der Versorgung. Hätte die Schweiz damals nicht mit den Nazis im wirtschaftlichen Bereich zusammengearbeitet, wäre es schwierig geworden. Das Land war ja umzingelt.
Und was heisst das heute in Bezug auf die EU?
Wir sind Weltmeister im Pragmatismus. Der Bund ist uneinheitlich aufgebaut – da ist auf der einen Seite Zürich, eine Wirtschaftsmacht sondergleichen, und auf der anderen Seite das ländliche Appenzell. Auf der nationalen Ebene werden aber Gesetze für alle gemacht. Das funktioniert sehr pragmatisch und häufig mit dem Zudrücken eines, wenn nicht gar beider Augen. Mit unserem Föderalismus wären wir eigentlich dafür prädestiniert, mit der EU durchzuwursteln. Doch exakt bei dieser Frage werden wir zu Rechtspuristen. Die SP flippt aus wegen irgendwelcher Anmeldefristen, die SVP stellt Europa sowieso infrage.
Wieso kriegen wir das nicht hin?
Der Bundesrat ist eine hoch performante Entscheidungsmaschine, er fällt pro Jahr etwa 2500 Entscheidungen, und zwar sehr effizient. Wie etwa während der Coronakrise. Vielleicht gab es einen Bundesrat, der etwas gebockt hat, aber es gab eine klare Federführung, und als Regierung war er voll entscheidungsfähig. Beim Europa-Dossier ist er aber blockiert, weil das Dossier alle Departemente betrifft. Da ist der Bundesrat in der Krise.
Der Historiker ist im Puschlav aufgewachsen, machte in Zuoz die Matur und studierte an der Uni Bern und an der University of North Carolina. Heute ist Zala Professor an der Uni Bern und Direktor der Forschungsstelle Diplomatische Dokumente Schweiz (Dodis). Er lebt in Spiegel bei Bern und ist seit 30 Jahren mit Andrea Schweizer, Rektorin der PH Zürich, liiert.
Die Schweiz hatte jahrelang den Ruf, die besten Diplomaten der Welt zu haben. Bei den Zollverhandlungen wurden wir abgewatscht, bei der F-35 müssen wir nun doch mehr zahlen, und bei der CS wissen wir auch nicht, ob noch Milliardenkosten auf uns zukommen. Was ist da los?
Bis zum Ersten Weltkrieg war der Bundespräsident jeweils auch Aussenminister. Bei Kriegsausbruch 1914 gab es im EDA 17 Angestellte, einer davon war der Bundespräsident. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts verantwortet daher das Volkswirtschaftsdepartment die Aussenhandelspolitik. Deshalb hat es mich auch genervt, als die Journalistinnen und Journalisten fragten: «Hätte nicht Bundesrat Cassis in die USA mitreisen müssen?» Dabei sind schon zwei Mitglieder des Bundesrats zu viel des Guten! Drei wären ein absoluter Kniefall gewesen. Der Schweizer Diplomatie vorwerfen, dass sie zu wenig macht, ist absurd!
Was ist anders als früher?
Die Rolle des Parlaments und der Medien ist heute eine ganz andere. Das Parlament spricht verstärkt mit, die Medien hinterfragen alles. Zudem instrumentalisieren Parteien die Krisen für ihre Zwecke. Das alles macht es für den Bundesrat viel schwieriger, die Schweiz zusammenzuhalten.
Wie gelingt es trotzdem?
Ein letzter Exkurs (schmunzelt). In den Jahren 1856/1857 stand der Kanton Neuenburg im Zentrum einer internationalen Krise. Der preussische König hatte Ansprüche auf das ehemalige Fürstentum erhoben. 1856 mobilisierte die Schweiz gleich zwei Divisionen, und Dufour – der Held des Sonderbundskriegs – wurde wieder zum General ernannt. Die Mobilmachung hat einen unglaublichen Patriotismus ausgelöst im Stil von: Jetzt zeigen wir es diesen Preussen. Dank dem externen Druck gelang es, die Fronten zu schliessen und die Urkantone in das liberale Projekt Bundesstaat zu integrieren. Krisen können den Patriotismus befeuern und das Land einen. Das sieht man jetzt sehr deutlich in Kanada, das auf die Angriffe von US-Präsident Trump sehr patriotisch reagiert. Wenn wir in die Zukunft schauen, hat Trump am Ende vielleicht mehr für die europäische Integration gemacht, als man sich das heute vorstellen kann.