Caroline Märki, der Titel Ihres Buches lautet «Kinder brauchen unperfekte Eltern». Was ist denn an Perfektion nicht gut?
Perfektion existiert im zwischenmenschlichen Kontakt nicht. Man findet sie vielleicht in der Mathematik, aber kaum in der Erziehung. Wer perfekt erziehen will, setzt sich selbst eine unmögliche Aufgabe. Das erzeugt viel Druck und dieser mündet in destruktiven Dynamiken. Ich reagiere gestresst, wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich es für perfekt halte. Und dieser Stress überträgt sich auf die anderen Familienmitglieder.
Dass Eltern nur das Beste für ihre Kinder wollen, auch was die eigene Erziehungsarbeit angeht, ist aber doch völlig normal.
Ja, so funktioniert unsere Gesellschaft. Wir werden von klein auf dazu erzogen, alles zu bewerten. In TV-Shows gewinnen die Besten, in der Schule erhalten die Besten eine Sechs. Wir lernen, wir erbringen Leistungen und wir werden bewertet. Man ist nur etwas wert, wenn man eine gute Bewertung erhält. Doch im Familienalltag funktioniert dieses Wertesystem nicht. Denn wie man erzieht, können wir nirgendwo lernen. Wir müssen es als Eltern selbst herausfinden.
Nie hatten Eltern so viele Informationen zur Verfügung, wie in Zeiten des Internets. Macht es das nicht einfacher?
Dass wir heute so viel mehr über die kindliche Entwicklung, überErziehung und den Menschen im Allgemeinen wissen, führt zu Unsicherheit. Denn dieses Wissen lässt uns auch fürchten, dass wir unserem eigenen Kind Schaden zufügen. Früher verbanden klare Werte die Gesellschaft, es gab einen Konsens darüber, was richtig oder falsch ist. Das ist verloren gegangen. Zum Glück, denn dadurch wurde eine neue Freiheit gewonnen. Ich darf es machen, wie ich es will. Nur führt diese neue Freiheit eben oft zu Unsicherheit. Man muss sich selbst darüber klar werden, was man denn genau will. Da passieren zwangsläufig auch Fehler oder die Dinge laufen nicht so, wie man sie sich vorgestellt hat. Und davor haben viele Eltern Angst.
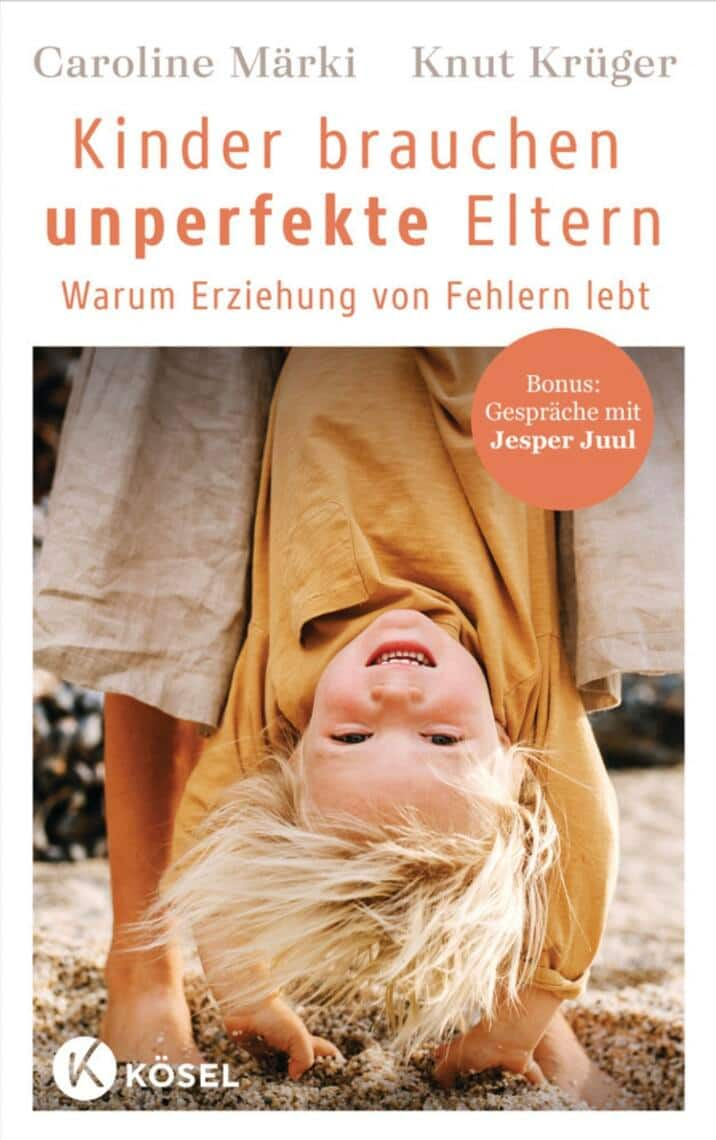
«Als Mutter oder Vater möchten wir möglichst alles richtig machen. Doch dabei übersehen wir, wie sehr Familien davon profitieren, wenn Eltern gerade nicht nach Lehrbuch erziehen», mit diesen Worten leiten Caroline Märki und Knut Krüger den Inhalt ihres Ratgeber-Buches ein. Es fordert Eltern auf, die Perfektion loszulassen, sich mit eigenen Fehlern zu versöhnen, authentisch, nahbar und umperfekt zu sein – das sei genau richtig für Kinder. Im «familylab»-Podcast spricht die Autorin darüber.
BuchcoverFehler vermeiden zu wollen, klingt zunächst nach etwas Gutem.
Fehler zu machen, ist unausweichlich. Anstatt sie unbedingt vermeiden zu wollen, wäre es wichtig, die Verantwortung dafür zu übernehmen, wenn sie passieren. Sie also nicht dem Gegenüber in die Schuhe zu schieben, sondern einen gelassenen Umgang damit finden. Das ist sehr einfach gesagt, die Umsetzung gestaltet sich schwierig, weil wir alle von unserer Vergangenheit geprägt sind – und da haben viele von uns leider keine guten Erfahrungen gemacht mit dem Fehler machen.
Und was passiert, wenn man in einer Familie versucht, Fehler zu akzeptieren?
Der Druck lässt sofort nach. In meinem Buch gebe ich dazu mehrere Beispiele aus meinem eigenen Familienalltag.
Können Sie uns eins davon erzählen?
Da kommt mir spontan eine Begebenheit in den Sinn, die ich so im Buch gar nicht erwähne. Als mein Sohn im Kindergarten war, habe ich ein Versprechen gebrochen, woraufhin er wütend wurde. Ich hatte ihm versprochen, dass wir gemeinsam im Restaurant zu Mittag essen würden, weil danach ein Kinderarzttermin anstand und das Restaurant ganz in der Nähe der Praxis lag. Aber dann trödelte er auf dem Heimweg und kam erst so spät zu Hause an, dass keine Zeit mehr für den Restaurantbesuch blieb. Ich bestrafte ihn nicht, es war einfach eine Tatsache, dass die Zeit zu knapp wurde, bevor der Arzttermin anstand. Mein Sohn war sehr enttäuscht und liess seine Wut unter anderem an den Sofakissen aus. Anstatt mich schuldig zu fühlen – oder, was häufig auch passiert, dem Kind die Schuld zuzuschieben – entschied ich mich jedoch, das Beste aus der Situation zu machen, seine Gefühle anzuerkennen und uns Sandwiches zu machen. Ich hätte gestresst reagieren und ihn anschreien können, weil er die Kissen warf. Das hätte eine destruktive Situation herbeigeführt. Aber ich blieb ruhig, akzeptierte, dass ich mein Versprechen gebrochen hatte und dass er nun wütend war. Irgendwann beruhigte er sich und sagte: So, ich räume nun die Sofakissen auf.
Wie erklären Sie sich das?
Ich war selbst ganz überrascht. Offenbar konnte er sich in meiner verständnisvollen, gelassenen Haltung so sehr beruhigen, dass er sogar ans Aufräumen dachte. Gleichzeitig setzte ich mich selbst nicht mit Schuldgefühlen unter Druck. Das entspannte die Situation. Allerdings tönt dieses Beispiel nun, als hätte ich perfekt reagiert. Dahinter stehen vier bis fünf Jahre Arbeit.
Inwiefern?
Ich brauchte Jahre, um mit der Wut meines Sohnes klar zu kommen. Meine bisherigen Reaktionen in Frage zu stellen, mich nicht schuldig zu fühlen, mein Kind nicht schuldig zu machen und damit weiteres Öl ins Feuer zu giessen – das alles brauchte viele Anläufe. In dieser Situation ist es mir gelungen angemessen zu reagieren, was eine Auswirkung auf mein Kind hatte und mich selbst sehr gefreut hat. Aber ich habe nicht ein Rezept, das in jeder Situation funktioniert. Es kommt immer auf den Kontext an. Schlussendlich geht es darum, zu akzeptieren, dass es nicht immer perfekt laufen kann und darauf gelassen zu reagieren.
Es geht also weniger um die Fehler selbst als um den Umgang damit?
Genau. Unvorhergesehenes oder Fehler passieren sowieso. Wir können das nicht vermeiden. Oft trägt dafür gar niemand die Schuld, wie im Fall des genannten Beispiels. Es war weder der Fehler meines Sohns, dass er später kam als sonst, noch mein Fehler, dass ich mein Versprechen nicht mehr halten konnte. Wir können das nicht kontrollieren. Was wir jedoch beeinflussen können, ist, wie wir damit umgehen. Quälen wir uns damit herum oder stehen wir dazu und übernehmen Verantwortung dafür?
Wie profitieren Kinder davon, wenn Eltern Fehler oder Unzulänglichkeiten akzeptieren?
Sie leben in einem entspannteren familiären Umfeld, was positiv auf ihre Stimmung und ihr Gemüt abfärbt, also letztlich auf ihre ganze Entwicklung. Sie lernen auch von ihren Eltern einen konstruktiven Umgang mit Fehlern und dass man sich selbst mit all ihren Ecken und Kanten zu akzeptieren darf. Das führt zu weniger Selbstzweifel und schafft die Grundlage für Resilienz. Das ist die Fähigkeit, Rückschläge zu verkraften und damit umzugehen, einen Sinn im Leben zu haben und gute Beziehungen aufzubauen. Das sind Grundbausteine für Gesundheit und Zufriedenheit im Leben.
Schadet Perfektionismus der Gesundheit und Zufriedenheit?
Kinder, die in perfektionistischen Familien aufwachsen, übernehmen oft diese Einstellung ins Erwachsenenalter. Sie erleben zuhause, dass sie geliebt werden, wenn sie den Erwartungen entsprechen oder herausragende Leistungen erbringen. Sich Liebe aufgrund von Verhalten zu verdienen, ist keine echte Nahrung für die Seele. Echte Nahrung ist Liebe, die nicht an Leistung gebunden ist. Ein klares «Ich liebe dich, wie du bist».
Beziehung vor Erziehung also. Wie funktioniert das?
Viele Eltern wollen ihre Kinder heute mit Liebe erziehen. Wer will das schon nicht. Viele wissen wie wichtig die Bindung und diese bedingungslose Liebe für eine gesunde Entwicklung vom Kind ist. Aber wie die Umsetzung in der Praxis aussieht wissen viele nicht. Was, wenn dein Kind auf Gegenstände einschlägt? Wenn es die Mutter oder den Vater extra beisst und mit schlimmen Worten beschimpft? Was bedeutet es in solchen Situationen das Kind mit all seinen Ecken und Kanten zu lieben?
Welche Antworten geben sie in ihren Beratungen auf diese Fragen?
Wenn in einer solchen Situation die Liebe (die Empathie) der Eltern zum Kind abhandenkommt, dann heisst das, dass es der Mutter/dem Vater gerade auch nicht gut geht. Damit meine ich, dass die Mutter/der Vater sich selbst gerade nicht gut akzeptieren können. Aus welchen Gründen auch immer. In diesen Momenten, welche übrigens kein Zeichen von schlechten Eltern ist, sollten sie sich zuerst um sich selbst kümmern. Eine kurze Pause nehmen, vielleicht schnell aufs WC gehen, sich reflektieren «wie geht es mir gerade? Was will ich? Was passiert gerade mit mir und meinem Kind?» ich traue vielen Eltern zu, dass sie in herausfordernden Situationen die richtigen Worte finden und auch Ideen haben, wie sie mit dem Kind umgehen könnten. Was vielen in den Weg kommt, ist die eigene Abneigung sich selbst gegenüber. Diese unbewusste Abneigung sich selbst gegenüber braucht manchmal professionelle Begleitung. Und hier sind wir wieder bei den Fehlern, die Eltern halt einfach passieren. Das lässt sich nicht ändern. Schon Jesper Juul sagte: Der schlimmste Fehler ist der Wunsch nach Perfektion.
Profitieren auch Eltern davon, nicht perfekt sein zu wollen?
Ganz klar. Sie gewinnen an Entspanntheit. Ich rate allen Eltern: Geht raus, tauscht euch aus. Viele Eltern sprechen aus Scham nicht über Fehler, die ihnen in der Erziehung passieren. Dabei würde man bei einem offenen und ehrlichen Austausch feststellen, dass viele ähnliche Herausforderungen haben. Aha, das ist normal. Aha, das ist nicht so schlimm. Aha, auch in anderen Familien gibt es mal Streit. Diese Erkenntnis kann dazu beitragen, dass Eltern nicht mehr so hart mit sich selbst ins Gericht gehen. Das Leben wird dadurch vielleicht nicht einfacher. Man trägt weiterhin Konflikte aus, hat mit Schwierigkeiten oder Problemen zu kämpfen. Aber das alles verliert die destruktive Dynamik.
